Die Debatte um gendergerechte Sprache ist nicht neu. In den letzten Jahren entwickelte sich aus der inzwischen oftmals schon gängigen Praxis, die Sprache zu „gendern“, also nicht nur die männliche Bezeichnung eines Wortes zu nutzen, sondern es auf die zwei biologisch scheinbar eindeutigen Geschlecher männlich und weiblich anzupassen (bspw. ArbeiterIn) die Forderung, auch jene Menschen in den Sprachgebrauch aufzunehmen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter eindeutig zuordnen wollen oder können. Die Reaktionen darauf, vor allem die negativen, lassen bei diesem Vorschlag nie lange auf sich warten und fallen häufig sehr heftig aus (vgl. dazu hier, hier und hier). Von „Genderwahnsinn“ ist die Rede, davon, dass die schöne Sprache wegen ein paar Menschen verschandelt werde, eine Bekannte sagte einmal, dann könne man ja auch gleich Ameisen in die Sprache miteinbeziehen.
Eine Frage, die sich nicht stellt
In diesen Reaktionen wird eins deutlich: Wir Menschen sträuben uns gegen alles, was unbekannt ist, was uns Aufwand bereitet, sofern wir selbst davon keinen Nutzen haben. Doch es geht auch um etwas anderes.
Diese Diskussion lebt davon, dass eine noch männlich dominierte, in zwei Geschlechtsrollen denkende Mehrheit versucht zu bestimmen, was angemessen, was notwendig ist und was überflüssig – und dies zu Lasten einer Minderheit, die sich in diesem Schwarz-Weiß-Denken nicht wiederfindet. Es geht in der Debatte auch nicht um den Dogmatismus verschiedener Wissenschaftler*innen, die der Mehrheit etwas aufzwingen wollen. Für die Durchsetzung einer gendergerechten Sprache ist es unerheblich, ob es dadurch 800, 80 000 oder 20 Millionen Menschen besser geht. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellt sich nicht, da in einer toleranten und offenen Gesellschaft die Mehrheit nicht darüber zu bestimmen hat, wie Minderheiten zu behandeln seien.
Gleichheit vor dem Gesetz, aber nicht in der Realität?
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat oder Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ So steht es in Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz. Doch wenn vor der höchsten Instanz der Demokratie, dem Gesetz, die Menschen gleichwertig behandelt werden, wie kann eine Gesellschaft etwas anderes fordern als genau das?
Wenn es der Realität entspricht, dass Menschen in ihrem Alltagsleben jede Minute an ihre Andersartigkeit, ihre Nicht-Zugehörigkeit erinnert werden, wenn sie sich entscheiden müssen, ob sie auf die Frauen- oder Herrentoilette gehen, welche Umkleide sie benutzen, wenn sie gezwungen werden, auf einem Formular ihr Geschlecht anzugeben, selbst wenn sie nur ein Auto mieten wollen, dann ist das Verschweigen der Existenz eines uneindeutigen Geschlechts und die Tabuisierung einer jeden Diskussion darüber ein deutliches Eingeständnis eben dieser Diskriminierung. Das Lächerlichmachen dieser sexuellen Identität ist gleichbedeutend damit, die Menschen in dem, was sie sind, lächerlich zu machen.
Vor wenigen Tagen beging die 17-jährige Transsexuelle Leelah Alcorn in den USA Suizid, weil sie aufgrund ihrer Sexualität eine erhebliche Diskriminierung erfuhr und auf breite Missachtung stieß. Die Facebook- Kommentare einiger deutscher Internetnutzer*innen dazu sollte man sich besser nicht durchlesen, wenn man sich weiter der Illusion hingeben möchte, in Deutschland gäbe es eigentlich keine Diskriminierung.
Der Streit um die richtige Form
Doch wenn man die Notwendigkeit erkannt hat, die Unsichtbarkeit von Menschen ohne eindeutige Geschlechtszugehörigkeit wegzunehmen, stellt sich die Frage, wie dies am besten zu lösen sei.Sollte man „man“ nicht konsequenterweise auch in „mensch“ gendern?
Ohne jeden Zweifel gibt es Vorschläge, die zwar in den Augen queer-feministisch aktiver Menschen absolut notwendig und wünschenswert wären, die aber ebenso wie beispielsweise eine konsequent fleischfreie Ernährung der Gesamtbevölkerung nicht umzusetzen sind. Dazu gehört der Vorschlag, den Fokus generell von einem klar oder auch nicht klar erkennbaren Geschlecht zu lösen und die Personen mit ihren Fähigkeiten, ihrem Charakter, in ihrer Individualität und als Mensch wahrzunehmen und wertzuschätzen. Dies wäre wünschenswert, wird aber in einer Gesellschaft wie der unseren, in der in den Augen Vieler lieber alles so bleiben soll, wie es ist, nicht von heute auf morgen passieren.
Oft angebracht wird das Argument, die Sprache könne durch Gendern unverständlich werden. Zweifelsohne ist es angebracht, sich dann zu fragen, ob der Unwillen, die Sprache zu verändern wirklich Priorität vor dem Recht auf Gleichheit haben sollte. Allerdings führen Vorstöße wie „ProfessorX“ leider nicht dazu, dass die Notwendigkeit eines Sprachwandels erkannt wird, sondern werden mit populistischen Phrasen abgeschmettert. Daher ist es notwendig, eine Formulierung zu finden, die erstens Sätze nicht unnötig in die Länge zieht („ArbeiterInnen und andere“), zweitens aber Raum lässt für all jene, die auch durch die sprachliche Missachtung diskriminiert werden.
Der bisher eleganteste Versuch, der auch in diesem Text Anwendung findet, ist der sogenannte „Genderstar“. Das * zwischen dem männlichen Wort und der Ergänzung „innen“ steht dabei für all jene, die sich nicht in eine der beiden Geschlechterkategorien einordnen wollen, behindert aber weder den Lesefluss noch wird dadurch ein Text besonders in die Länge gezogen. Über die Frage, inwiefern das Wort „man“ angepasst werden sollte, herrscht Uneinigkeit. Die Autorin folgt in diesem Zusammenhang der Argumentation, dass das Wort heutzutage durch einen Bedeutungswandel für „jeder beliebige Mensch“ verwendet wird und daher eine entsprechende Umwandlung nicht zwingend notwendig ist.
Ein unbequemer Prozess
In einem Land, in dem bis vor wenigen Jahren homosexuelle Handlungen unter Minderjährigen unter Strafe standen, dessen Einwohner stetig älter werden und in dem die Kirche noch immer einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat, sind auch dringend notwendige Minderheitenpositionen nicht durchsetzbar, wenn sie nicht die Akzeptanz der Mehrheit finden. Daher ist es notwendig, Probleme und Diskriminierungen nicht totzuschweigen, sondern aktiv zu thematisieren. Wenn Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest gewinnt, muss man die Musik nicht mögen, aber es zeigt, dass gesellschaftliche Prozesse möglich sind. Überschaubarkeit und einfache Erklärungen, die den Lebensalltag Aller betreffen werden noch immer lieber entgegengenommen als abstrakte Vorschläge, die die Mehrheit der Menschen nicht betreffen. Es müssen also Wege geschaffen werden, um die Unsichtbaren zuallererst einmal sichtbar zu machen und dabei ist eine gendergerechte Sprache der erste Schritt.
Die Verantwortung der Mehrheit
Das Frauenwahlrecht, die Entkriminalisierung homosexueller Beziehungen, das Recht der Frauen auf Scheidung – das alles wäre nicht möglich gewesen ohne eine gesellschaftliche Debatte, die dazu führte, dass die vorherigen Regelungen unhaltbar wurden. Auch der feministische Diskurs ist noch lange nicht am Ende angelangt, genauso wenig wie die Debatte um die Rechte Homosexueller (und zwar trotz einer weiblichen Kanzlerin und eines ehemaligen schwulen Außenministers). Doch muss die Vielschichtigkeit der Debatte an die Bevölkerung herangetragen werden. Es gibt nicht nur weiblich und männlich, nicht nur homo und hetero, nicht nur dick oder dünn, deutsch oder nicht-deutsch. Die Gesellschaft ist bunt und vielfältig und nur, weil ein Mensch nicht in bestimmte Schubladenhi neinpasst, ist er nicht weniger Teil des Ganzen.
Die Toleranz einer Gesellschaft zeigt sich daran,wie sie mit ihren Minderheiten umgeht – bezogen auf inter- und trans*sexuelle Menschen ist die deutsche Gesellschaft bei weitem nicht so tolerant, wie es gerne dargestellt wird.
Der Artikel erschien zuerst auf Impuls der Zeiten.
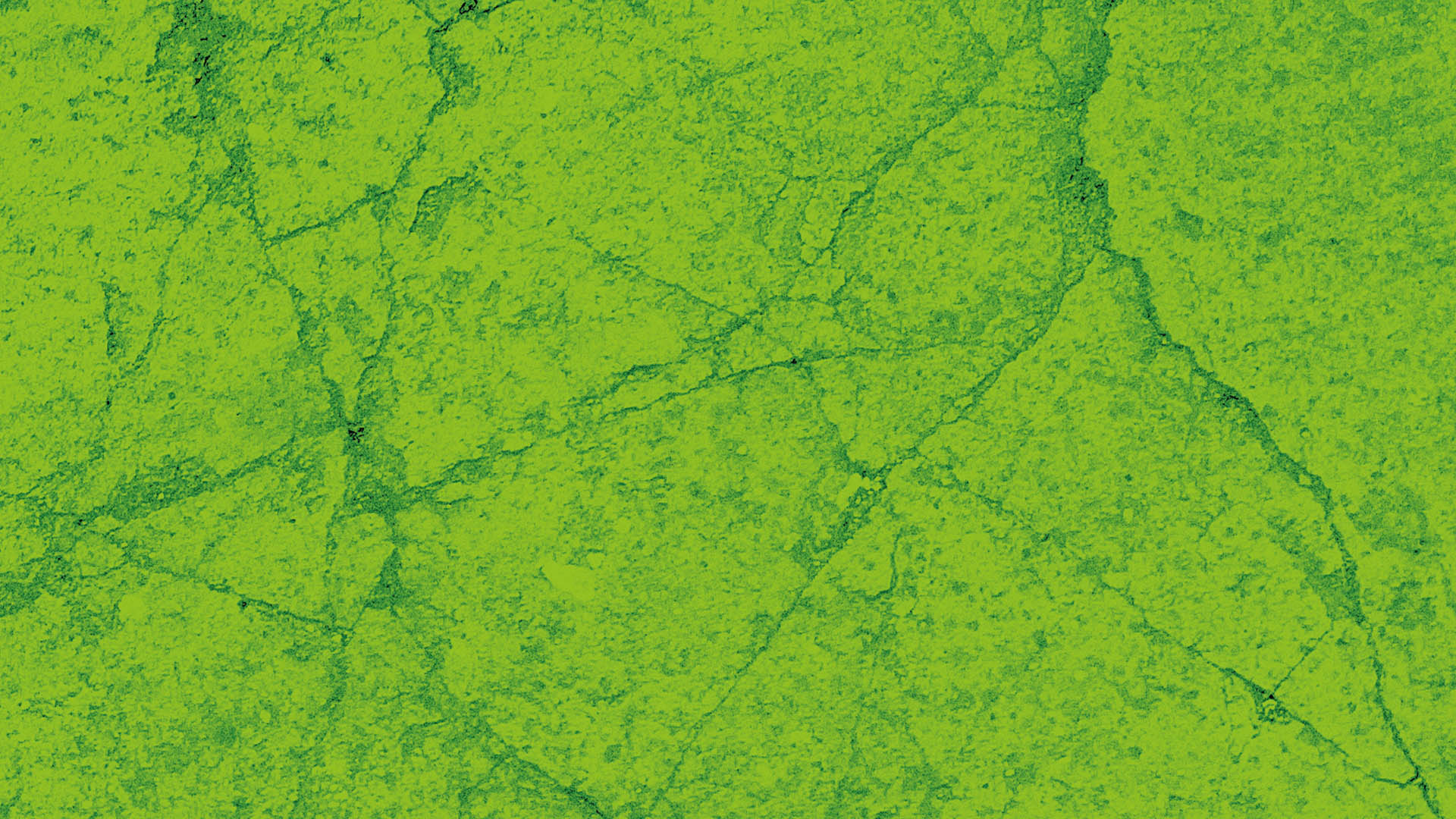


Schreibe einen Kommentar